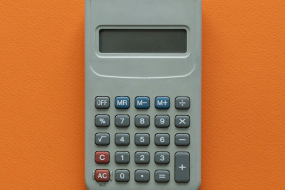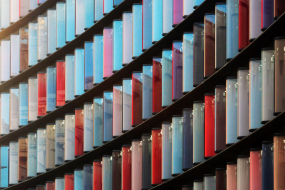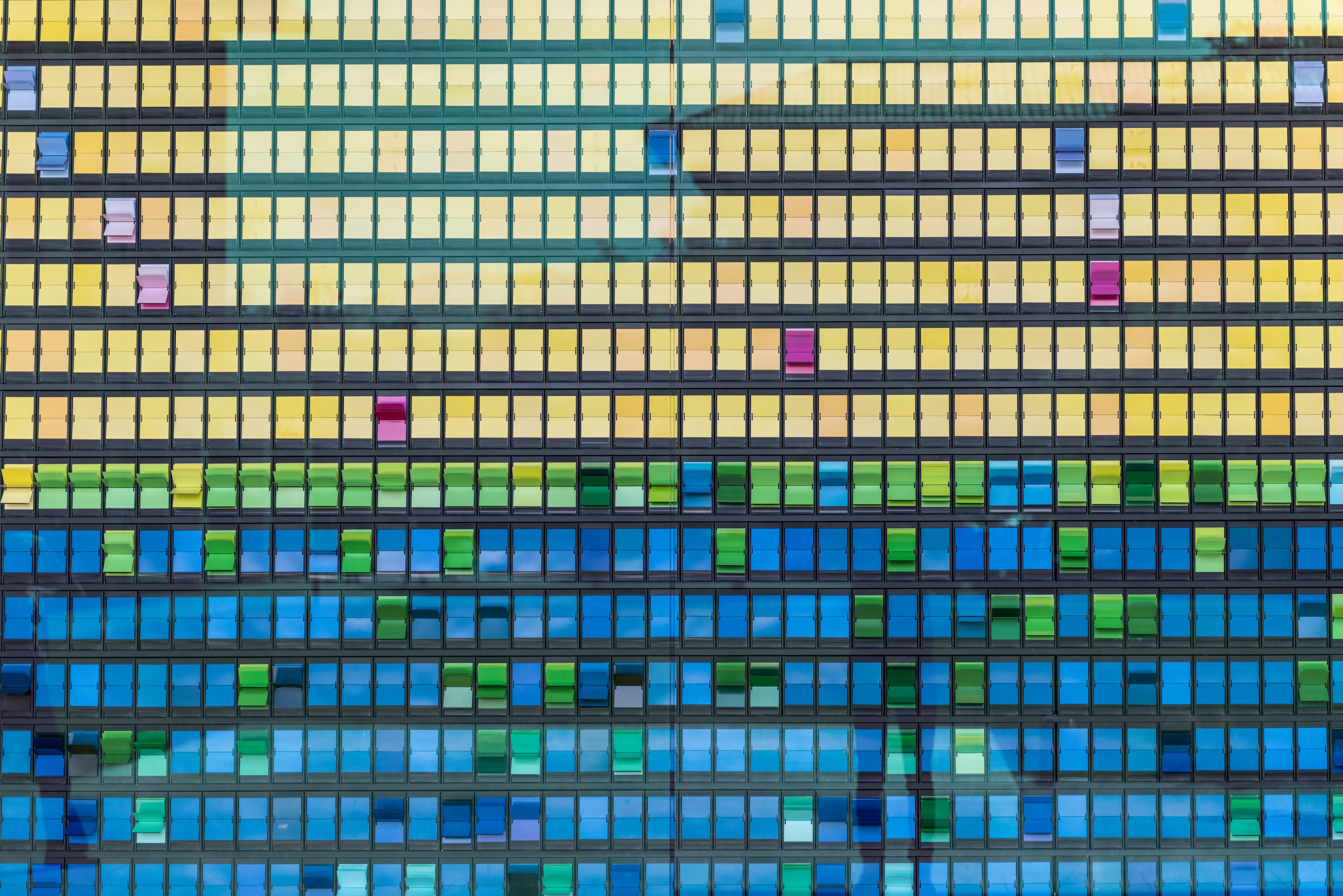
Digitale Verwaltung
Wo wir stehen & was wir wollen
Die Digitalisierung des öffentlichen Sektors hat in den zurückliegenden Jahren auf der Prioritätenliste von Politik und Verwaltung erheblich an Bedeutung gewonnen. Doch trotz unzähliger Strategien, Abstimmungsforen und Wettbewerbe war die öffentliche Verwaltung hinsichtlich ihrer IT-Infrastruktur nicht ausreichend auf die Corona-Krise vorbereitet. Um auch in Krisenzeiten die politische sowie wirtschaftliche Handlungsfähigkeit zu erhalten, bedarf es einer umfassenden Digitalisierung und Modernisierung von Bund, Ländern und Kommunen. Das bedeutet: Digitale Technologien müssen genutzt werden, um Verwaltungsverfahren zu beschleunigen und staatliche Akteure in ihrer Aufgabenwahrnehmung zu stärken. Dabei müssen öffentliche Leistungen für die Breite der Gesellschaft online zur Verfügung stehen und die digitalen Angebote sollten dabei konsequent an den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer ausgerichtet sein. Ziel muss es sein, eine zukunftsfeste Verwaltung zu entwickeln, die so agil und modern ist, wie die Gesellschaft, der sie dient.

Handlungsempfehlungen
Einheitliches digitales Zugangstor zur Verwaltung etablieren
Das Onlinezugangsgesetz (OZG) sollte konsequent umgesetzt und für die Zeit nach 2022 weiterentwickelt werden. Viele OZG-Leitungen sind bislang nur in einzelnen Bundesländern oder Kommunen pilotiert. Vielmehr müssen jedoch alle Verwaltungsleistungen flächendeckend und durchgehend online zugänglich sein. Die digitalen Angebote werden zudem nur dann auf breite Akzeptanz stoßen, wenn sich die Nutzerinnen und Nutzer nicht an verschiedenen Portalen anmelden oder unterschiedliche Nutzerkonten verwenden müssen. Die Integration von Onlineportalen, die Interoperabilität der digitalen Angebote und die Umsetzung des Once-Only-Prinzips sind deshalb zentrale Erfolgsfaktoren bei der Verwaltungsmodernisierung.
Modernisierung der IT-Infrastruktur durch konsequenten Ausbau der Cloud-Nutzung vorantreiben
Gerade in Krisenzeiten müssen Verwaltungen flexibles digitales Arbeiten und einen mobilen sicheren Datenzugriff garantieren. Den Anforderungen an Verfügbarkeit und Skalierbarkeit wird man durch den konsequenten Einsatz von Cloud Computing Diensten gerecht. Im Sinne einer souveränen Nutzung von Cloud Leistungen können Verwaltungen auf sogenannte Multi-Cloud-Modelle setzen und so Abhängigkeiten von einzelnen Anbietenden verhindern. In Deutschland und Europa haben sich bereits vielfältige Standards, Normen, Codes of Conduct und Zertifikate für die Cloud-Nutzung durchgesetzt oder werden derzeit erarbeitet. Im Public Sector hat sich insbesondere der Cloud Computing Compliance Controls Catalogue (C5-Katalog) für Informationssicherheit etabliert. Daten in Public Clouds können durch clientseitige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, durch die Fragmentierung und Verteilung der Daten auf mehreren Cloud-Speichern und ein striktes Rollen- und Rechtemanagement wirksam geschützt werden.
Öffentliche Beschaffung weiter digitalisieren
Die Lieferantenverpflichtung zur elektronischen Rechnungsstellung für alle öffentliche Aufträge ab November 2020 kann nur ein erster Schritt bei der vollständigen Digitalisierung der Beschaffungsprozesse im öffentlichen Sektor darstellen. Für einen starken digitalen Staat ist eine konsequente Digitalisierung von der Bedarfsmeldung bis zur Zahlung erforderlich, dies umfasst auch die Nutzung strukturierter, elektronischer Bestellformate wie Order-X.
Nachhaltigkeit und Transparenz staatlichen Handelns durch den Einsatz digitaler Technologien stärken
Die Corona-Pandemie hat offengelegt, dass innovative, digitale Lösungen gefordert sind, um die Krisenfestigkeit staatlicher Organisationen zu verbessern. Erforderlich sind in diesem Zusammenhang eine end-to-end-Digitalisierung und Teilautomation von Verwaltungsprozessen, proaktives Verwaltungshandeln sowie die konsequente Nutzung öffentlicher Daten. Digitale Technologien (bspw. aus den Bereichen Advanced Data Analytics, Process Automation oder Virtual Reality) sollten bei der Verwaltungsmodernisierung stärker genutzt werden. Dadurch können nicht nur die Effizienz und Effektivität staatlichen Handelns verbessert werden, sondern es ergeben sich auch neue Potenziale, die Transparenz staatlicher Verfahren und Entscheidungsprozesse gegenüber Bürgern sowie Unternehmen zu erhöhen. Die im Koalitionsvertrag vorgesehene Beschleunigung von Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren kann nur gelingen, wenn Rechtsbegriffe vereinheitlicht, verwaltungsinterne Prozesse vollständig digitalisiert und die Registermodernisierung konsequent vorangetrieben wird.
Datenbereitstellungsanspruch schaffen
Der freie Zugang zu und die breite Nutzung von Daten bilden eine wichtige Säule für die Digitalisierung der Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Bitkom setzt sich daher für eine weitere Ausbreitung und Nutzung von Open Data ein. Insbesondere sollte der Staat eine Vorreiterrolle in diesem Kontext einnehmen und mit Open Government Data voranschreiten. Dazu braucht es vor allem die Öffnung kommunaler Datenbestände, die Harmonisierung offener Daten über Standards und die Bereitstellung von Experimentierräumen für die Nutzbarmachung von Open Data. Der im Koalitionsvertrag vorgesehene Rechtsanspruch auf Open Data muss so ausgestaltet werden, dass Daten der Bundesverwaltung zukünftig grundsätzlich veröffentlicht werden und Ausnahmen von dieser Regel durch die zuständige Behörde zu begründen sind.