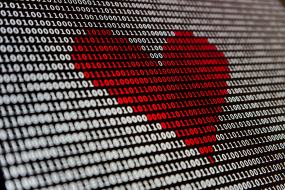Gesundheit
Wo wir stehen & was wollen wir
In einem zeitgemäßen Gesundheitswesen sollte stetig daran gearbeitet werden, die Gesundheitsversorgung aller Menschen passgenauer zu gestalten. Dieses Ziel verfolgt auch die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Die Voraussetzung dafür ist die Bereitstellung sicherer Infrastruktur, die Unterstützung interoperabler Anwendungen im Gesundheitswesen sowie die Etablierung eines fairen und standardisierten Datenökosystems. Durch die Digitalisierung werden alle am Behandlungsprozess Beteiligten miteinander vernetzt. So ist es möglich, den Nutzen für die Patientinnen und Patienten in den Vordergrund zu stellen. Die Digitalisierung bietet dabei neben den Chancen für die Patientenversorgung auch einen erheblichen Beitrag zu mehr Effizienz und Kosteneinsparungen.
Mit der Roadmap für die Einführung einer elektronischen Patientenakte (ePA) und den angekündigten Wechsel auf ein opt-out-Modell arbeitet die Bundesregierung daran, die jahrelange Stagnation der Digitalisierung im Gesundheitswesen zu überwinden. Gleichwohl nährt die Verschiebung der E-Rezept-Einführung jedoch Zweifel am notwendigen Durchsetzungswillen. Um digitale Großprojekte zum Erfolg zu führen, braucht es jedoch eine an einem gemeinsamen Zielbild ausgerichtete Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen. Es gilt Akzeptanz zu schaffen, um so die Potenziale für die Patientenversorgung und Forschung tatsächlich zu realisieren. Das Ziel muss jetzt sein, die Bedingungen für ein vielfältiges digitales Gesundheits-Ökosystem zu schaffen, damit Patientinnen und Patienten zukünftig schneller den Zugang zu innovativen und personalisierten Behandlungsmöglichkeiten finden.


Re-Start Deutschland!
Die aktuelle Bitkom-Position zu Gesundheit finden Sie im Wahlpapier zur Bundestagswahl 2025.
Handlungsempfehlungen
E-Rezept einführen und elektronischen Patientenakte weiterentwickeln
Zentrale Game-Changer für die Versorgungsqualität im deutschen Gesundheitssystem wie die ePA im opt-out-Verfahren und das E-Rezept müssen schnellstmöglich flächendeckend und anwenderfreundlich nutzbar werden. Die elektronische Patientenakte muss als zentrale Behandlungsplattform mit weiteren Anwendungen wie dem E-Rezept zusammenspielen. Dem E-Rezept kommt dabei die Rolle eines Digitalisierungsbotschafters zu, denn sie führt Patientinnen und Patienten sowie Ärztinnen und Ärzte den Zusatznutzen digitaler Anwendungen unmittelbar vor Augen. Auf Grundlage der medizinischen Informationsobjekte (z. B. E-Impfpass) müssen sinnvolle Mehrwerte für die Versorgung etabliert werden. Vor allem an diesen zentralen Anwendungen müssen frei verfügbare und standardisierte Schnittstellen zur Verfügung gestellt werden (z.B. für Drittanbieter, Warenwirtschaftssysteme und weitere Anwendungen). Die Forschungskompatibilität der ePA muss sichergestellt werden. Damit für Patientinnen und Patienten ebenso wie Anbietende und Herstellende Planungssicherheit wiederhergestellt wird, muss schnellstmöglich ein neues Startdatum für die verpflichtende Nutzung des E-Rezept genannt werden.
Diskriminierungsfreien Nutzungsrahmen für Gesundheitsdaten erarbeiten
Gesundheitsdaten sind bislang nur unzureichend erschlossen und rechtlich nutzbar. Eine verbesserte Erschließung anwendungsbezogener Daten würde mehr Evidenz und innovative Therapien für Patientinnen und Patienten ermöglichen. Eine diskriminierungsfreie Nutzung muss dabei von Anfang an mitgedacht werden. Das neu geschaffene Forschungsdatenzentrum kann uns diesem Ziel näherbringen. Dafür muss sich der Zugang zu Daten künftig allein am legitimen Nutzungszweck und der Geeignetheit der Daten für diesen Zweck orientieren. Für diese aggregierten oder pseudonymisierten Daten braucht es ein transparentes Antragsverfahren und einen vertrauenswürdigen Nutzungsrahmen. Der Koalitionsvertrag sieht auch vor, die medizinische Registerlandschaft besser zu erschließen. Es gilt daher einen Nutzungsrahmen für die nicht-öffentliche Forschung zu eröffnen und die Anforderungen zum Einbezug in die Nutzenbewertung praxisgerecht auszugestalten.
Videosprechstunde mit der Behandlung vor Ort gleichstellen und Telemedizin ausbauen
Auch vier Jahre nach Öffnung des Fernbehandlungsverbots ist die Videosprechstunde nicht mit einer Behandlung vor Ort gleichgestellt. Hier erfordert es Anpassungen in Berufsordnungen, Abrechnungs- und Vergütungsmodalitäten sowie verlässlichen Rahmenbedingungen bei der Zertifizierung von Anbietenden. Um neue telemedizinische Angebote in die Regelversorgung zu bringen, müssen Anwendungen wie elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, E-Rezept, Terminvergab und DiGA für Anbietende, Ärztinnen und Ärzte und Patientinnen und Patienten diskriminierungsfrei nutzbar sein. Um die Versorgungsqualität zu erhöhen, müssen zudem Bausteine wie das Hinzuziehen von spezialisierten (Fach-) Ärztinnen und Ärzten (Telekonsil) und ein regelmäßiger Austausch behandlungsrelevanter Daten strategisch, konsequent und nachhaltig vorangetrieben werden. Die Etablierung eines Telemedizinischen Versorgungszentrums (TMVZ) als neuer Leistungserbringer wäre ein konsequenter und rechtlich zügig umsetzbarer Schritt.
Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA und DiPA) in den Versorgungsalltag integrieren
Mit der Einführung von DiGA und DiPA wurde erstmalig eine digitale und zugleich sehr innovative Leistungskategorie im GKV-System geschaffen. Nun muss die Integration in den Versorgungsalltag von Patientinnen und Patienten, Behandelnden und allen weiteren Akteuren folgen. Ein innovations-offener Rechtsrahmen sollte so weiterentwickelt werden, dass ein Technologietransfer durch DiGA-Herstellenden in die Versorgungsrealität ermöglicht wird. Neben Information und Aufklärung ist die Schaffung eines Ökosystems für digitale Gesundheitsversorgung der Schlüssel zur weiteren, erfolgreichen Etablierung einer Weltneuheit. Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzte sowie Krankenkassen benötigen einen rechtssicheren Rahmen, um individuelle digitale Behandlungsangebote und Therapieoptionen nutzen zu können. Für die Therapieadhärenz ist entscheidend, dass alle beteiligten Akteure in den digitalen Versorgungsprozess eingebunden sind und diesen unterstützen.