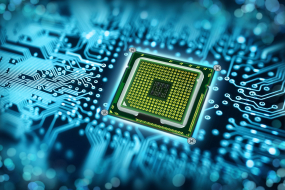Startups
Wo wir stehen & was wir wollen
Zu den wertvollsten Unternehmen der Welt zählen zahlreiche ehemalige Startups. Sie entwickeln neue Technologien und Geschäftsmodelle, die ganze Wirtschaftszweige neu gestalten. Für die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit ist es daher maßgeblich, dass Deutschland mit den großen Startup-Nationen Schritt hält. Um gegenüber der europäischen und internationalen Konkurrenz bestehen zu können, muss das Tempo der letzten Jahre bei der Förderung von Startups aber nicht bloß gehalten, sondern erhöht werden. Von hoher Bedeutung für die Attraktivität eines Startup-Standorts ist die Verfügbarkeit von Kapital und Talent. Beide Faktoren stehen in einem Verhältnis wechselseitiger Sogwirkung. Sie sind maßgeblich dafür, ob ein Ökosystem »nur« in der Lage ist, gute Geschäftsideen, oder in der Folge auch globale Digital-Champions hervorzubringen. Gelingt dieser Übergang, wächst der Startup-Standort künftig aus sich selbst heraus – und weniger staatliche Hilfestellung wird benötigt. An diesem Punkt ist Deutschland noch nicht. Daher muss es jetzt im Interesse der Politik liegen, die richtigen Weichen für einen kapitalstarken Startup-Standort, an dem die klügsten Köpfe aus aller Welt die größten Innovationen von morgen entwickeln, zu stellen. Um diese Ziele auch zu erreichen, hat sich die Regierung viel vorgenommen. Nun gilt es, dass diese Punkte mit höchster Priorität umgesetzt werden.


Re-Start Deutschland!
Die aktuelle Bitkom-Position zu Startups finden Sie im Wahlpapier zur Bundestagswahl 2025.
Handlungsempfehlungen
Finanzierungsturbo einlegen
In den vergangenen Jahren konnte ein Anstieg von Gründungen beobachtet werden. Nicht zuletzt ein Verdienst von staatlichen Förderungen, die z.Z. insbesondere auf die frühen Phasen der Unternehmensentwicklung ausgerichtet sind. Nun gilt es die Programme fortzuführen und weiterzuentwickeln. Im Gegensatz zur Gründungsfinanzierung liegt Deutschland bei der Wachstumsfinanzierung nach wie vor zurück. Deshalb begrüßen wir ausdrücklich, dass Startups in der Spätphasenfinanzierung unterstützt und der Venture-Capital-Standort gestärkt werden soll. Dabei soll der Fokus noch stärker auf der Erschließung neuer Investorengruppen, wie Pensionskassen, Versicherungen oder anderen institutionellen Investoren, liegen, um den Zugang zu Wagniskapital für Hightech-Startups zu verbessern. Die Beteiligung Deutschlands am ETCI zur Förderung europäischer Startups in der Wachstumsphase ist ebenfalls ein Schritt in die richtige Richtung. Das Startup-Ökosystem profitiert von einer gemeinsamen europäischen Strategie. Diese Vorhaben müssen jetzt mit höchster Priorität umgesetzt werden.
Talente anziehen
Neben Kapital ist die Verfügbarkeit von qualifizierten und talentierten Arbeitskräften eine der zentralen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Startup-Ökosystem. Maßgeblich für deren Verfügbarkeit, sind u.a. die Rahmenbedingungen von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen in Startups. Denn die Attraktivität von Unternehmen wird nicht mehr nur an der direkten monetären Vergütung bemessen, sondern hängt auch davon ab, ob Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens partizipieren können. Hier liegt Deutschland im internationalen Vergleich auch nach dem jüngsten Reformversuch weit zurück. Nun gilt es, bei einigen Kernpunkten noch einmal nachzusteuern:
- Ein maximales Alter des Startups von 12 Jahren ist insbesondere für forschungsintensive Unternehmen ein Nachteil. Der Zeitraum sollte mindestens, wie in Frankreich, auf 15 Jahre verlängert werden.
- Der Anwendungsbereich muss erweitert werden. Der aktuelle Schwellenwert von 250 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 50 Mio. EUR bestraft wachstumsstarke Unternehmen.
- Die Dry-Income-Problematik, also die Besteuerung ohne Liquiditätszufluss, muss überwunden werden. Hierfür sollte die zeitliche Befristung von 12 Jahren gelöst werden, da ein EXIT innerhalb dieses Zeitraums keineswegs garantiert ist. Auf eine Besteuerung beim Wechsel des Arbeitgebers sollte verzichtet werden. Alternativ sollte der Arbeitnehmer beim Wechsel verpflichtet werden, den fortgeführten Besitz der Anteil nachzuweisen, um erst bei der Veräußerung der Anteile einer Besteuerung zu unterliegen.
Potenziale nutzen
Für einen echten Innovationsschub müssen Ausgründungen aus Wissenschaft und Forschung vorangetrieben werden. Daher begrüßen wir, dass Hochschulen Mittel des Bundes zur Schaffung einer Gründungsinfrastruktur bereitgestellt werden sollen. Neben einer flächendeckenden Beratung in den Bereichen Finanzierung, Strategie und Wissenstransfer, muss eine technische und räumliche Infrastruktur für Gründende verpflichtend angeboten werden. Zusätzlich sollte an Hochschulen ein fachübergreifendes Modul »Entrepreneurship« eingeführt werden, sodass Unternehmertum als valider Karriereweg etabliert wird. Damit mehr Innovationen deutscher Spitzenforschung den Weg zur Marktreife finden, sollte für alle Transferstellen die Verpflichtung gelten, von Beginn an transparente Lizenzverträge anzubieten.
Gründerinnen fördern
Um die Anzahl von Gründerinnen zu erhöhen, sollte der Staat als Vorbild vorangehen und Investmentteams öffentlicher Fonds sowie Entscheidungsgremien für Startup-Förderungen paritätisch besetzen. Deshalb begrüßen wir, dass die Regierung die Beteiligung von Frauen in Investment-Komitees von staatlichen Fonds und Beteiligungsgesellschaften deutlich stärken möchte. Um das Know-how für Unternehmensgründungen weiter zu stärken, sollten die Weichen dafür früh gestellt werden. Unternehmensgründung und digitale Kenntnisse wie Coding sollten daher strukturiert Einzug in die Lehrpläne der Schulen finden.
Mit Startups zusammenarbeiten
Im Koalitionsvertrag wird ein vereinfachter, rechtssicherer Zugang für Startups und junge Unternehmen zu öffentlichen Aufträgen in Aussicht gestellt. Durch eine stärkere Berücksichtigung vielversprechender Startups bei der Vergabe öffentlicher Aufträge profitieren Staat und Wirtschaft von deren Innovationsfreude und Reaktionsfähigkeit. Mit ihren Ideen können Startups neben der Digitalisierung der Verwaltung auch Jahrhundertprojekte wie die Verkehrs- und Energiewende voranbringen. Startups wiederum brauchen zahlende Kunden, um sich am Markt zu etablieren. Um dies zu ermöglichen, müssen bestehende innovative Vergabekriterien und -verfahren vermehrt angewendet werden. Für Beschaffer müssen verpflichtende Schulungsangebote zu eben diesen Instrumenten geschaffen werden. Die Anforderungen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge müssen weg von einer vollständigen Risikoeliminierung und hin zu einem angemessenen Risikomanagement. Projekte sollten dabei möglichst ansatz- und technologieoffen ausgeschrieben werden. Besonders der Mittelstand hängt bei der Digitalisierung noch weiter hinterher. Innovative Startups sind hierbei ein wichtiger Hebel, um KMU bei der digitalen Transformation zu unterstützen. Damit der Mittelstand in Deutschland mit seinen zahlreichen Hidden-Champions auch noch in Zukunft zur Weltspitze gehört, sollte die Regierung in der nächsten Legislaturperiode Förderprogramme für KMU für die digitale Transformation entwickeln. Hiervon profitieren KMU, aber auch Startups, da sie sich durch die Aufträge auf dem Markt etablieren können.
Mehr Europa wagen
Damit Startups zu Scaleups werden, benötigen sie einen niederschwelligen Zugang zu hinreichend großen Märkten. Hier sind Unternehmen aus China oder den USA bislang im Vorteil. Zur Förderung vielversprechender, innovativer Startups führt daher kein Weg am europäischen Digitalen Binnenmarkt vorbei. Bedingungen für Investoren sollten EU-weit vereinheitlicht werden. Dazu braucht es eine EU-weite Startup-Definition, steuerrechtliche Vergünstigungen. Langfristig sollten Steuerrecht und Gründungsvoraussetzungen EU-weit angeglichen und eine »EU-GmbH« etabliert werden.