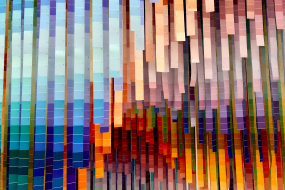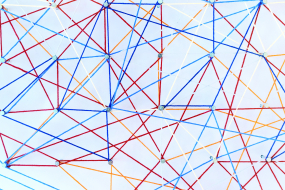Innovationsförderung & Technologiepolitik
Wo wir stehen & was wir wollen
Forschung und Entwicklung, kurz FuE, sind die Triebfedern für Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum sowie der Schlüssel zu digitaler Souveränität. Das ambitionierte Ziel der Politik, den Anteil der FuE-Aufwendungen bis 2025 auf 3,5 Prozent des BIP zu steigern, ist daher ausdrücklich zu begrüßen. Mit der Einführung der steuerlichen Forschungsförderung ist bereits ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung getan. Das in den letzten Jahren entstandene forschungs- und innovationspolitische Förderinstrumentarium gilt es nun nachzujustieren und an die neuen Herausforderungen anzupassen. Dabei muss auf die richtige Balance von themenoffener und themenzentrierter Förderung geachtet werden.
Um sich im globalen Innovationswettlauf an die Spitze zu stellen, ist es unabdingbar, die FuE-Politik europäisch zu denken. Nur im gemeinsamen Schulterschluss lassen sich die Investitionen stemmen und die erforderlichen Skalen- bzw. Netzwerkeffekte heben. Die FuE-Politik muss durch eine moderne und wettbewerbsfördernde Industriepolitik flankiert werden. Dabei gilt: Offene und resiliente Systeme, fairer Wettbewerb und ein Level Playing Field schaffen die besten Voraussetzungen für Innovation und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit.

Re-Start Deutschland!
Die aktuelle Bitkom-Position zu Standort, Steuern & Innovationsfähigkeit finden Sie im Wahlpapier zur Bundestagswahl 2025.
Handlungsempfehlungen
Ziele verfolgen
Das 3,5-Prozent-Ziel gibt eine quantitative Orientierung und sollte weiterhin von Staat und Wirtschaft verfolgt werden. Aber: es darf nicht allein um die Zahl als solche gehen, sondern vor allem darum, die Mittel zielführend zu verwenden. Die Innovationsförderung und die Technologiepolitik sollten an einer strategischen Orientierung zu mehr Wachstum, Souveränität, Resilienz und Nachhaltigkeit durch Digitalisierung ausgerichtet werden. Der Anspruch sollte sein, dass Deutschland im europäischen Schulterschluss Schlüsseltechnologien, Geschäftsmodelle und Ökosysteme mitgestalten kann.
Digitale Souveränität schaffen
Das Bekenntnis zum Ziel der digitalen Souveränität und zur Förderung digitaler Schlüsseltechnologien sollte von der Bundesregierung noch stärker in den Fokus der Forschungspolitik genommen werden. Angesichts des globalen Wettbewerbs einerseits sowie der hohen Innovationsdynamik andererseits kann Deutschland nicht bei allen digitalen Technologien vorn mitspielen, sondern muss sich auf einige wenige, dafür aber besonders wichtige konzentrieren. Daher gilt es Kriterien zur Identifikation digitaler Schlüsseltechnologien zu entwickeln. Mit einem Kriterienkatalog können die zur Auswahl stehenden Technologien evaluiert werden. Zudem ist ein nationales Monitoring einzurichten, um den Fortschritt bei der Entwicklung der Schlüsseltechnologien – insbesondere im internationalen Kontext – zu überwachen. Außerdem bedarf es ein nationales Diskussionsforum, auch unter Beteiligung von Industrie und Forschung, dass die Bundesregierung in ihren Entscheidungen bei der Auswahl von Schlüsseltechnologienberät.
Eine F&I Landschaft mit System und Synergie
Die Gründung der Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (DATI) kann aus Sicht der Bitkom einen wichtigen Beitrag leisten, um durch anwendungsorientierte Forschung und Transfer regionale sowie überregionale Innovationsökosysteme zu schaffen. Wichtig ist es dabei, die DATI sinnvoll in die deutsche Forschungs- und Innovationslandschaft einzubetten. Insbesondere gilt es das Zusammenspiel mit der erst jüngst gegründeten Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) sowie der Digital Hub Initiative und ihren zwölf lokalen Kompetenzstandorten zu klären, um ineffiziente Doppelstrukturen sowie Lücken in der Förderung zu vermeiden. Die DATI muss mit ihrem regionalen Fokus die Arbeit der SPRIND und der Digital Hub Initiative komplementär ergänzen, die Umsetzung der Ideen in den Markt unterstützen und beschleunigen. Prozesse vereinfachen: Mit der angekündigten Vereinfachung der Verfahren der Forschungsförderung möchte die Ampel den richtigen Weg gehen. Hiervon würde vor allem der Mittelstand profitieren. Denn angesichts komplizierter und langwieriger Bewilligungsverfahren verzichten viele KMUs auf eine Beteiligung an der öffentlichen Forschungsförderung. Dadurch bleiben wertvolle Innovationspotentiale in Deutschland & Europa brach liegen. Die angekündigten Vereinfachungen sollte daher nicht nur in Krisensituationen und für prioritäre Handlungsfelder, sondern permanent und für alle Handlungsfelder gelten. Hierfür sind die heutigen Bewilligungsverfahren auf das beihilfe- und haushaltrechtliche Notwendige zu reduzieren und die Prozesse vollständig zu digitalisieren – z.B. durch Wegfall der Papier- und Unterschriftenerfordernis.
Anreize setzen
Damit die Unternehmen ihre Forschungsaktivitäten am heimischen Standort ausbauen, benötigen sie international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen. Neben dem Ausbau der gezielten Projektförderung von strategischen Verbundprojekten, die insbesondere durch große Unternehmen getrieben werden, ist auch die steuerliche Forschungsförderung eine Stellschraube mit großer Hebelwirkung. Das in Deutschland noch junge Instrument wurde im Zuge der Corona-Hilfsmaßnahmen bereits durch die Anhebung der Bemessungsgrundlage temporär erweitert. Um insbesondere innovative KMU in der Breite zu unterstützen, gilt es diese Stärkung zu verstetigen: In der nächsten Legislaturperiode sollte die Förderquote von 25 Prozent auf 50 Prozent verdoppelt werden.
Industriepolitik modernisieren
Im Digitalzeitalter ist Industriepolitik gleichbedeutend mit Innovations- und Digitalpolitik. Wir begrüßen, dass existierende Instrumente, wie etwa die wichtigen Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse (IPCEI), verstärkt für digitale Technologien wie Cloud-Infrastrukturen und Mikroelektronik genutzt und zügig umgesetzt werden. Durch die kurzen Innovationszyklen gilt es diese Instrumente sachgerecht weiterzuentwickeln und inhaltlich den besonderen Bedingungen der digitalen Wirtschaft anzupassen – das heißt vor allem, die Bewilligungsverfahren in den IPCEIs zu beschleunigen. Zudem ist der Blick nach vorne zu richten: Bereits etablierte Technologien reaktiv zu kopieren, wird nicht verfangen. Vielmehr müssen wir die Fähigkeit stärken, potenzielle Sprunginnovationen frühzeitig zu erkennen, sie mit geeigneten Förderinstrumenten zur Marktreife zu bringen und am Weltmarkt zu etablieren.